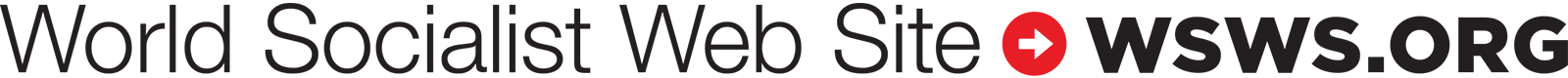Am vergangenen Sonntag legte die Führung der SPD den Grundstein für den Börsengang der Deutschen Bahn AG und damit für die Privatisierung des letzten großen Staatsunternehmens in Deutschland. Für die Beschäftigten wie für die Reisenden verheißt dieser Schritt nichts Gutes. Stellenabbau, Lohnkürzungen, mangelhafter Service bei steigenden Preisen und wachsendes Sicherheitsrisiko werden über das längst bekannte Maß hinaus die unvermeidlichen Folgen sein, wenn künftig der Börsenwert die Strategie des Unternehmens bestimmt.
Das Präsidium der SPD einigte sich auf einen Kompromiss, nach dem das Transportgeschäft der Bahn, also der Personen- und Güterverkehr, zu 24,9 Prozent an private Investoren abgegeben werden soll. Die Einigung wurde möglich, als der Parteivorsitzende Kurt Beck von seinem Versuch abließ, die widerstreitenden Tendenzen in der SPD durch einen eigenen Kompromissvorschlag zu versöhnen, und sich stattdessen einer abgeschwächten Version des von SPD-Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee entwickelten Holdingmodells - und damit dem rechten Flügel der Partei - anschloss.
Das brachte ihm die wohlwollende Anerkennung nicht nur seiner parteiinternen Kritiker, sondern ebenso der Regierung, des Koalitionspartners CDU und der FDP ein. Auf alle Fälle hat er damit seinen schwankenden Posten als Vorsitzender der SPD wieder etwas befestigt und ein Auseinanderbrechen der großen Koalition zumindest aufgeschoben.
Noch im Herbst des vergangenen Jahres hatte ein SPD-Parteitag beschlossen: "Private Investoren dürfen keinen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben. Zur Erreichung dieses Ziels stellt die stimmrechtslose Vorzugsaktie die geeignete Form dar. [...] Eine andere Beteiligung privater Investoren lehnen wir ab."
Mit ihrer Entscheidung setzt sich die Führungsriege der SPD nicht nur über den Beschluss des Parteitages hinweg, und damit über den Willen der Mehrheit ihrer eigenen Basis. Vor allem stellt sie sich einmal mehr einer allgemeinen Stimmung in der Bevölkerung entgegen, um die Interessen der Wirtschaft durchzusetzen. Einer aktuellen Emnid-Umfrage zufolge lehnen 70 Prozent der Bevölkerung jede Kapitalprivatisierung bei der Bahn ab. Unter den SPD-Anhängern lag die Ablehnung bei dieser Umfrage sogar bei 73 Prozent. Jeder Vierte von ihnen will seine Entscheidung bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr von dieser Frage abhängig machen.
Diese weit verbreitete Ablehnung in der Bevölkerung entspringt nicht nur dem verständlichen Misstrauen gegen alle Projekte der Großen Koalition, die den Menschen noch jedes Mal zum Nachteil gereichten, sondern vor allem den eigenen Erfahrungen seit der Bahnreform 1994, die zur Entstehung der Deutschen Bahn AG führte.
Seitdem hat das Unternehmen mehr als die Hälfte der damals 500.000 Beschäftigten freigesetzt, die Fahrkarten für viele Menschen unerschwinglich gemacht, 10.000 Kilometer des Gleisnetzes, d.h. jeden vierten Kilometer, abgebaut und dadurch weite Strecken jenseits der ICE-Trassen unerreichbar gemacht, trotzdem jährlich 12-15 Milliarden Euro öffentlicher Gelder versenkt und die Katastrophen von Eschede und Brühl verursacht, bei denen zusammen 110 Menschen zu Tode kamen - alles im Namen der Effizienzsteigerung zur Vorbereitung des Ganges an die Börse. Jeder ahnt, dass sich dieser Prozess im Zuge der Privatisierung fortsetzen und beschleunigen wird.
Diese Stimmung fand ihren Niederschlag in der SPD selbst und führte zu einer monatelangen Auseinandersetzung, die die Partei zu zerreißen drohte. Dabei ging es aber nicht um die Frage, ob man privatisieren solle oder nicht, sondern lediglich darum, wie man den Schein der öffentlichen Kontrolle über das größte Transportunternehmen Europas aufrecht erhält und gleichzeitig diese Kontrolle gegen klingende Münze eintauscht. Oder einfacher ausgedrückt: Der Streit drehte sich darum, wie man die Öffentlichkeit betrügen muss, um den Wirtschaftsinteressen dienstbar zu sein.
So ist denn auch der gefundene Kompromiss, den Beck als "rational sauberes und ökonomisch verantwortliches Modell" bezeichnet, vom Standpunkt der Menschen, die damit leben und arbeiten müssen, vor allem verantwortungslos und irrational.
Zunächst einmal bedeutet das Holding-Modell eine Trennung von Netz und Verkehr, da das Netz, die Infrastruktur, also Schienen, Bahnhöfe und Stromleitungen zu 100 Prozent in öffentlicher Hand verbleiben sollen. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen in Großbritannien, wo eine Reihe schwerer Unglücke auf die Trennung von Fahrweg und Betrieb zurück zu führen waren, ist eine solche Entscheidung schon beinahe kriminell. Zwar gingen seinerzeit die Briten noch weiter, da sie auch den Fahrweg in private Hände legten. Doch wird jetzt in Bezug auf die Deutsche Bahn der erste Schritt getan, indem man mindestens zwei unterschiedliche Entscheidungsträger mit zum Teil gegensätzlichen Interessen für das seinem Wesen nach untrennbare System Zug-Schiene ermöglicht.
Hinzu kommt, dass die bisherigen Versuche, das komplexe Unternehmen Deutsche Bahn in verschiedene unabhängige Bereiche aufzuspalten, lediglich dazu dienten, die Filetstücke des Konzerns von den unrentablen Bereichen zu lösen, um letztere besser abstoßen zu können. Der Preis für die Rennstrecken, die Berlin, Hamburg, Köln und Frankfurt miteinander verbinden, liegt in der Ausdünnung oder Einstellung des Betriebes in der Fläche. Der Berliner Beratungsfirma KCW zufolge werden künftig im Osten Deutschlands nur noch Berlin, Leipzig und Jena voll in den Fernverkehr integriert sein. Alle anderen größeren Städte, darunter sämtliche Landeshauptstädte der östlichen Bundesländer, werden in ihrer Anbindung stark eingeschränkt oder vom Fernverkehr ganz abgehängt.
Der scheinbar geringe Anteil von 24,9 Prozent der Transportsparte, den private Investoren erwerben dürfen, soll angeblich den Charakter der Bahn als Mittel der öffentlichen Daseinsvorsorge sichern, weil privaten Anlegern damit sowohl ein Sitz im Aufsichtsrat versagt bleibt, als auch eine Sperrminorität unmöglich gemacht wird. Das Modell von Tiefensee sah noch den Verkauf von 49,9 Prozent vor.
Doch das ist ein übler Trick, mit dem man die Kritiker betäubt, während man die Schleusen für das private Kapital öffnet. 49,9 Prozent wären in einem ersten Schritt ohnehin kaum zum Verkauf angeboten worden. Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) geht sogar davon aus, dass bei der aktuellen Finanzmarktkrise das Bahnpaket gegenwärtig gar nicht an der Börse platzierbar ist. Welche Zahl die SPD in ihr Modell schreibt, ist für den Einstieg in den Verkauf selbst völlig ohne Belang.
Ist der Reigen aber erst einmal eröffnet, gibt es nicht die geringsten Garantien dafür, dass die Privatisierung bei 24,9 Prozent enden wird. Über eine zweite oder dritte Verkaufsrunde wird dann kaum noch gesprochen werden. Der Verweis einer künftigen Regierung auf die chronisch klammen öffentlichen Kassen wird dann genügen.
Die Financial Times Deutschland zitiert den Bahnexperten der Beraterfirma KCW, Michael Holtzhey, zu dieser Frage: "Bei der nächsten Konjunkturdelle im Bundeshaushalt bekommen die Investoren 49,9 Prozent und dann mittelfristig die Mehrheit eingeräumt." Schutz durch Sperrminoritäten bezeichnet er als "alte, naive Staatsdenke von Leuten, die die Mechanismen des Kapitalmarktes nicht kennen".
Auf der anderen Seite ist es ein Trugschluss, dass Aktionäre erst einen Aufsichtsratsposten bräuchten, um Einfluss auf das Unternehmen zu erlangen. Aktionäre entscheiden über das Schicksal eines Unternehmens nicht im Aufsichtsrat, sondern an der Börse. Einmal auf dem Finanzmarkt angekommen, unterliegt jedes Kapital den dortigen Zwängen. Die Deutsche Bahn AG unterwirft sich bereits seit 14 Jahren diesen Zwängen, noch bevor der erste Anteilsschein verkauft ist. Schon im Jahr 2000 erklärte der damalige und heutige Vorstandsvorsitze der Deutschen Bahn AG, Hartmut Mehdorn, dass es darum gehe, "wie überall in der Industrie üblich die Effizienz des Unternehmens jedes Jahr um fünf Prozent zu steigern".
Über den zu erwartenden Erlös des Verkaufs kann natürlich nur spekuliert werden, gerade angesichts der schon erwähnten Turbulenzen auf den Finanzmärkten. Aber zwei Dinge können mit Sicherheit gesagt werden. Erstens wird die Summe nur einen Bruchteil des Werts des Unternehmens betragen, den das Verkehrsministerium selbst in offiziellen Statistiken ausweist und der bei 55,4 Milliarden Euro liegt, für 25 Prozent also etwa bei 14 Milliarden Euro. Wenn im günstigsten Fall fünf Milliarden Euro erlöst werden, wie in der Presse spekuliert wird, dann haben sich zwei Drittel des darin enthaltenen öffentlichen Anlagevermögens in Luft aufgelöst. Zweitens wird von der Verkaufssumme wiederum nur ein knappes Drittel für Investitionen bei der Bahn eingesetzt werden, die doch als eigentliche Begründung für die Unvermeidlichkeit einer Privatisierung der Bahn herhalten mussten. Der Rest landet zum Teil im Bundeshaushalt, zum anderen Teil bei der Deutschen Bahn zur Erhöhung des Eigenkapitals, möglicherweise um die Managergehälter der Zukunft abzusichern.
In der Reaktion der Bahngewerkschaften spiegelt sich vor allem die Sorge um ihre eigene Rolle nach einer Privatisierung wider. TRANSNET und GDBA unterstützen seit langem das Holdingmodell von Verkehrsminister Tiefensee. Sie bestehen lediglich darauf, dass dabei die Interessen als Gewerkschaftsbürokratie "in Verträgen oder ähnlichem sauber abgesichert werden".
Der Vorsitzende der GDBA, Klaus-Dieter Hommel, versucht sich sogar als Antreiber der Privatisierung. Eine gemeinsame Presseerklärung beider Gewerkschaften Anfang des Monats zitiert ihn mit den Worten: "Die schlechteste Lösung wäre aus unserer Sicht ein bloßes Verharren in der jetzigen Situation. Das würde die Deutsche Bahn im Wettbewerb zurückwerfen und die Schiene insgesamt nicht voranbringen." Er fordere eine "zügige politische Entscheidung". Die Teilprivatisierung sei kein Selbstzweck, es gehe um eine Stärkung der Schiene insgesamt.
Die Gewerkschaft der Lokführer GDL lehnt zwar eine Privatisierung ab und führt die zu erwartenden Streckenstilllegungen und Arbeitsplatzverluste als Begründung an. Gleichzeitig unterstützt sie aber die Unterwerfung der Bahn unter den internationalen Wettbewerb, was ihrer Meinung nach auch ohne private Investoren möglich sei. Auf ihrer Website ist zu lesen: "So vertritt die GDL die Auffassung, dass die DB ihre Position im nationalen und internationalen Wettbewerb auch ohne Börsengang ausbauen kann. Mit der nachgewiesenen Leistungsbereitschaft der Eisenbahner und unter Ausschöpfung ihrer eigenen Potenziale ist dies ohne weiteres möglich."
Unter der "Leistungsbereitschaft der Eisenbahner" versteht die GDL ihre Bereitschaft, die Interessen der Beschäftigten der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens unterzuordnen. Mit ihren Zugeständnissen bei dem jüngst zu Ende gegangenen Streik der Lokführer hat sich die GDL diesbezüglich die besten Referenzen erworben.