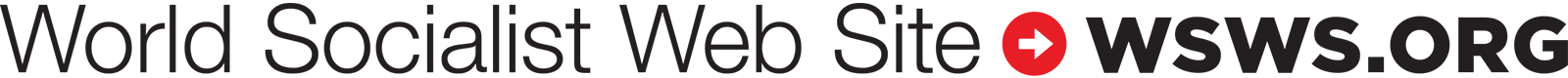Im öffentlichen Dienst nehmen Kampfbereitschaft und Wut der Beschäftigten zu. Sie wenden sich gegen wachsenden Arbeitsstress, Personalmangel und Dumpinglöhne und kritisieren verfallende Schulen und heruntergewirtschaftete öffentliche Einrichtungen. Am Dienstag nahmen parallel zu Berlin auch in Nordrhein-Westfalen tausende Lehrer und Erzieher an Warnstreiks teil, und am Mittwoch wurden in Bayern und Hessen die Unikliniken bestreikt.
Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi organisiert, wie schon letzte Woche im Ruhrgebiet, meist voneinander isolierte, kurze Warnstreiks, um „Dampf“ abzulassen. Trotz der Kampfbereitschaft in den Betrieben möchte die Gewerkschaft, wie auch die Landesregierungen, möglichst in den nächsten Tagen in Potsdam zum Abschluss kommen.
In Nordrhein-Westfalen zogen am Dienstag 10.000 Streikende vor den Landtag in Düsseldorf. Darunter waren viele Lehrer, Sozialpädagogen und Pflegekräfte, sowie auch Feuerwehrleute und Angestellte aus dem Verwaltungs- und Justizbereich. Auch in Hamm gingen am selben Tag rund 3000 Streikende für mehr Geld auf die Straße.
In Düsseldorf sagte Harald, ein Lehrer aus Duisburg, der WSWS, dass die mangelhafte Stellenversorgung an seiner Schule zu einer unerträglichen Gesundheitsbelastung und einem hohen Krankenstand führe. Durch den Unterrichtsausfall würden wesentliche pädagogische Ziele nicht mehr erreicht. „Die Konzentrationsfähigkeit der Schüler lässt nach, der ständige Lehrerwechsel beunruhigt die Lerngruppen, diese wenden sich von vielen Anforderungen ab, weil sie ihre Lage nicht mehr verstehen.“
Der Lehrer fuhr fort: „Die Realität des Krankenstandes wurde und wird einfach aus den Tarifverhandlungen ausgeblendet. Den Schulleitungen wird nicht die Möglichkeit gegeben, mit einer Vertretungsreserve, also mit einer zusätzlichen um 5 Prozent höheren Dauerversorgung, die ausfallenden Stunden ohne Verzug abzudecken.“
Harald berichtete, dass er mit der Forderung nach Ablehnung der Privatisierung in der Bildung auf positive Reaktionen gestoßen sei. Eine Lehrerin aus Hamm habe ihm gesagt, dieses Thema habe ihren Nerv getroffen: „Sie sagte, ihre ehemalige Schule sei nach und nach dem Verfall überlassen worden, es sei wie auf der Müllhalde gewesen, ein echter Entsorgungsfall.“ In einigen Klassen habe es, der Lehrerin zufolge, viele Stühle gegeben, auf die man sich nicht mehr gefahrlos habe setzen können. Inzwischen sei die Schule geschlossen worden.
Er selbst glaube, dass dies kein Zufall sei. „In Mülheim/Ruhr ist man schon dazu übergegangen, Schulgebäude an einen privaten Investor zwecks Sanierung zu überschreiben. Diese von der Stadt hoch gepriesene Aktion hat sich aber schnell als Reinfall herausgestellt. Denn nun hat die Schulleitung es ständig mit einer Rechtsabteilung des Bauträgers zu tun, der alles daransetzt, alle Reparaturaufträge aus vertraglichen Gründen abzuweisen, um möglichst viel Geld einzusparen.“
Auch nach der Demonstration wollen Harald und seine Kollegen ihre Diskussionen an der Schule fortsetzen. „In den letzten Tagen wurde deutlich, dass die GEW auch in dieser Tarifrunde nichts Wirkungsvolles unternimmt, um Lehrer und Schüler aus ihrer unhaltbaren Lage zu befreien. Lehrer sind darauf angewiesen, sich unabhängig von der GEW zu organisieren.“
Auch in den Krankenhäusern nimmt der Pflegenotstand akute Formen an. Dort fehlen zehntausende Fachkräfte, Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern, die Beschäftigten schieben Überstunden ohne Ende und werden schlecht bezahlt. In Hessen wurden im Jahr 2006 die Unikliniken Marburg und Gießen privatisiert, und das Uniklinikum Frankfurt wird seit Jahren einem strikten Regime unterworfen, um aus den roten Zahlen herauszukommen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi trägt diese Politik seit Jahrzehnten mit und sorgt für den reibungslosen Ablauf.
Seitdem vor Jahren der öffentliche Dienst in mehrere Tarifgebiete aufgesplittert wurde, gehört Hessen zwar dem Tarifvertrag der Länder (TV-L) nicht mehr an, wohl aber das Frankfurter Klinikum, das gemeinsam mit der Goethe-Universität eigene Tarifhoheit hat. Auch an diesem Klinikum rief Verdi deshalb am Mittwoch zu einem Warnstreik auf, dem im Ganzen etwa 120 Personen folgten.
Am Rande der Aktion äußerten Mitglieder des Klinikpersonals Unmut über diese Taktik isolierter Einzelaktionen. „Eigentlich müssten die den ganzen öffentlichen Dienst dichtmachen“, meinte die Krankenschwester Kim. Sie hatte sich dem Zug angeschlossen, weil sie, wie sie sagte, „endlich auf bessere Anerkennung unserer Arbeit“ hoffe. „Bei uns im Klinikum wird es mit den Arbeitsbedingungen immer schlimmer statt besser“, sagte Kim. Sie finde es „schade, dass wir nur immer so kleine Aktionen machen. Von den andern Leuten im öffentlichen Dienst kriegen wir hier überhaupt nichts mit.“
Jacqueline, Theresa und Daniela arbeiten auf der anästhesiologischen und kardiologischen Intensivstation. Sie kommen gerade von der Nachtschicht, als sich die Streikenden vor dem Tor der Uniklinik versammeln. „Was sind schon sechs Prozent?“ fragt Daniela sarkastisch mit Blick auf ein Verdi-Transparent. „Das ist eigentlich ein Witz.“
„Sozial sind wir wirklich schlecht aufgestellt“, fährt sie fort. „Gerade Berufsgruppen, bei denen es nicht um Rüstung und Waffengeschäfte geht, die sozial engagiert sind und von Mensch zu Mensch handeln, sind extrem schlecht bezahlt.“
Eine bessere Bezahlung sei schon dazu nötig, um „den Nachwuchs zu locken“, wirft Jacqueline ein. „Das Hauptproblem in unserm Alltag ist die permanente Unterbesetzung. Wir müssen ständig Prioritäten setzen und Wichtiges zurückstellen. Das ist unbefriedigend. Wir sind unterbesetzt und überfordert.“ Sie wünsche sich, für das Geld, das sie verdiene, deutlich mehr Freizeit zu haben: „Für mich wäre das Wichtigste, dass ich mich vom Dienst wieder erholen und auskurieren könnte.“
Daniela schildert, wie ihre Arbeit konkret aussieht: „Wir fahren 58km weit zur Arbeit. Wir arbeiten am Bett und geben hundert Prozent, betreuen die Patienten wirklich intensiv, und schaffen doch nicht alles, weil die Zeit einfach nicht reicht. Wir übernehmen ärztliche Tätigkeiten, müssen dokumentieren, müssen so viel leisten, dass wir nicht einmal dazu kommen, uns eine halbe Stunde hinzusetzen, um ein Glas Wasser zu trinken oder ein Brot zu essen.“ Die andern fallen ein: „Wir schaffen es nicht, unsere eigentlichen Aufgaben zu erfüllen: für die Patienten und die Angehörigen da zu sein, ihnen die Ängste und Sorgen zu nehmen. Es muss alles schnell laufen: Zack-zack.“
In der Nachtschicht, so Daniela, sei oft „nur eine Pflegekraft für (gefühlt) dreißig Patienten vorhanden – das geht einfach nicht!“ Theresa ergänzt: „Die Kliniken achten darauf, dass das Ganze noch irgendwie funktioniert. Deshalb sind vor allem die Normalstationen vom Personalmangel betroffen.“ Auf der Intensivstation falle ihr aber auf, dass die Qualität der Ausbildung schlechter geworden sei. „Den jungen Leuten, die neu kommen, fehlt vor allem Teamgeist und der Blick für das Gemeinsame. Aber gerade das ist bei uns wichtig. Das hat in der Ausbildung extrem nachgelassen.“
Darunter leiden die drei Krankenschwestern, die seit Jahren auf der Intensivstation zusammenarbeiten. „Auf der Intensivstation steht der Patient wirklich auf der Schwelle zwischen Leben und Tod“, erklärt Jacqueline. „Da geht es immer noch um Menschen. So ein Patient ist ein Vater, ein Bruder, ein Sohn. Mit welchem Argument sind diese Zustände zu rechtfertigen?“ Sie weist darauf hin, dass dies ein Ergebnis der Klassengesellschaft sei. „Die Politiker haben keine Vorstellung von den Auswirkungen“, sagt Jacqueline, „denn sie liegen auf der Privatstation, sie werden chauffiert, sie kriegen besondere Aufmerksamkeit. Deshalb werden die Zustände nicht geändert, obwohl jeder darüber Bescheid weiß.“
Angefangen habe das Ganze mit der Privatisierung, erklärt Daniela. Sie berichtet von Erfahrungen aus andern Kliniken, in denen sie schon gearbeitet hat. „Auch Politiker und Privatpatienten kamen auf die Station. Einige von ihnen haben ihre eigene Security mitgebracht, einer sogar sein eigenes Sofa. Sie erhielten bestens ausgestattete Intensivpflege. Von uns wurde dabei das Doppelte an Qualität und Privatpflege verlangt, obwohl andere Patienten uns dringender gebraucht hätten. Umgekehrt ist von diesem Geld kein Pfennig beim Pflegepersonal angekommen.“
„Wer steckt sich denn das ganze Geld in die Taschen?“ fragt Jacqueline. „Wer profitiert davon, dass wir Überstunden machen und länger bleiben, und dass wir Abstriche an unserm Privatleben machen? Das ist eine ganz kleine Minderheit. Aber sie entscheidet, wie alles läuft.“ Als Beispiel erwähnt sie den Besitzer und Chef des Amazon-Konzerns, Jeff Bezos, der sich die Washington Post kaufte, um die öffentliche Meinung zu lenken: „Allein die Vorstellung, dass solche Leute die ganze Politik bestimmen, macht mich krank.“
Auf die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi angesprochen, winken die drei ab – von deren Bilanz halten sie wenig. „Wozu hat das Ganze geführt?“ fragt Jacqueline. „Immer wieder sind Stellen gestrichen worden. Trotzdem hat’s irgendwie funktioniert. Die Ausfälle und Missgeschicke, die zwangsläufig waren, wurden untern Teppich gekehrt, und irgendwie ging es immer weiter. Es geht in der Politik nur noch um Kosten, um die Wirtschaftlichkeit. Denn das wirklich Teure am Betrieb, das sind die Personalkosten.“