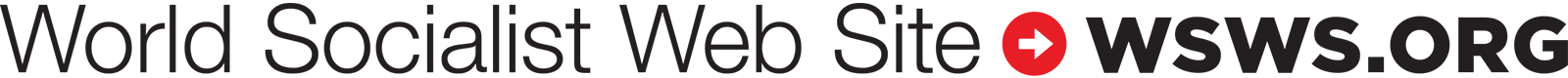Letzten Mittwoch hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Änderung des sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) beschlossen. Dieser ergänzt eine Änderung vom 19. Februar dieses Jahres. Mit den Änderungen werden die Überwachung und Zensur des Internets drastisch verschärft. Selbst Großanbieter wie Google und Facebook, die sonst eng mit der Regierung zusammenarbeiten, haben schwerwiegende rechtliche Bedenken erhoben.
Das NetzDG verpflichtet Anbieter sozialer Medien wie Facebook, Youtube und Twitter seit Januar 2018 dazu, bestimmte Meinungsäußerungen zu löschen. Sind diese rechtswidrig, muss die Löschung innerhalb einer Woche erfolgen, sind sie „offensichtlich rechtswidrig“ sogar innerhalb von 24 Stunden.
Die Frage, ob eine Meinungsäußerung rechtswidrig ist, die oft schwierig und Gegenstand langwieriger juristischer Auseinandersetzungen ist, wird von den Internetkonzernen entschieden. Diese müssen dem Staat halbjährlich Transparenzberichte erstatten. Kommen sie ihren Verpflichtungen nicht ausreichend nach, drohen Bußgelder bis zu 50 Millionen Euro.
Für fälschliches Löschen drohen demgegenüber keine Strafen. Das Overblocking, das sich daraus ergibt – „lieber zu viel als zu wenig löschen“ –, ist ein beabsichtigtes Ergebnis der Konstruktion. Dieses Kernstück des NetzDG – kurze Fristen zur Prüfung bei gleichzeitig hohen Bußgeldandrohungen für Nicht-Löschen – bleibt bestehen.
Die Bundesregierung geht in der Gesetzesbegründung sogar davon aus, dass für die Prüfung von Beschwerden, die nicht offensichtlich unbegründet oder ein Verstoß gegen die eigenen Richtlinien des Anbieters sind, im Durchschnitt 20 Minuten, erforderlich sind. Für zehn Prozent der Fälle, bei denen eine „vertiefte Prüfung“ und ein „hohes Qualifikationsniveau“ erforderlich sind, rechnet sie durchschnittlich mit 60 Minuten!
Bemerkenswerterweise findet sich diese Angabe im Abschnitt „Erfüllungsaufwand“ der Gesetzesbegründung. Die Bundesregierung kalkuliert damit ein, dass die Internetkonzerne eine ernsthafte Prüfung von Meinungsäußerungen auf Rechtswidrigkeit – die in 20 bis 60 Minuten kaum zu leisten ist – schon allein aus Kostengründen nicht durchführen werden, sondern im Zweifel lieber schnell löschen und melden.
Künftig sollen die Anbieter großer sozialer Netzwerke darüber hinaus verpflichtet werden, dem Bundeskriminalamt (BKA) als Zentralstelle bestimmte strafbare Inhalte zu melden, die ihnen durch eine Beschwerde bekannt und von ihnen entfernt oder gesperrt wurden.
Zu den rechtswidrigen Inhalten, die von der Meldepflicht an das BKA erfasst werden, gehören laut Bundesregierung das Verbreiten von Propagandamitteln und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§§ 86, 86a StGB), Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat (§§ 89a, 91 StGB), Volksverhetzungen und Gewaltdarstellungen (§§ 130, 131 StGB) und Morddrohungen (§ 241 StGB).
Solche Meldungen sollen erleichtert werden. Die „leichte Bedienbarkeit“ und Erreichbarkeit bei „der Wahrnehmung des Inhalts“ werden ausdrücklich vorgeschrieben. In der Praxis soll das einen Button zur direkten Meldung neben jedem einzelnen Beitrag bedeuten.
Dafür soll das Bundeskriminalamt sachlich und personell aufgestockt werden. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) sprach in einem Interview mit dem „Morgenmagazin“ von 300 neuen Stellen.
Zudem sollen mit dem Änderungsgesetz auch europarechtliche Vorgaben umgesetzt werden. Dabei geht es um neue Vorgaben bei Videosharingplattform-Diensten. Solche Plattformen seien teilweise bereits vom NetzDG umfasst, teilweise müssten aber Regelungen auch für kleinere und themenspezifischere Anbieter aufgenommen werden. Die Gesetzesbegründung geht von einem zusätzlichen Aufkommen von jährlich 100.000 Beschwerden über rechtswidrige Inhalte durch die neu erfassten Anbieter aus.
Die Netzwerke müssen Posts immer dann melden, wenn „konkrete Anhaltspunkte“ bestehen, dass sie etwa den Tatbestand einer Volksverhetzung oder Morddrohung erfüllen. Google, das mit YouTube eines der betroffenen Netzwerke betreibt, merkte dazu in seiner Stellungnahme an, dass dadurch „eine umfassende Datenbank beim Bundeskriminalamt über Nutzer und die von ihnen geposteten Inhalte zum Zwecke der Strafverfolgung“ aufgebaut werde, die ihresgleichen suche.
Die rechtliche Einordnung von Kommentaren auf den sozialen Netzwerken sei zudem eine hochkomplexe Angelegenheit, kritisiert auch der Deutsche Anwaltsverein (DAV). Damit steige die Gefahr, dass auch völlig harmlose Inhalte gemeldet werden. „Das Bundeskriminalamt bekommt neben den beanstandeten Äußerungen die digitalen Adressdaten zur Identifizierung/Verifizierung des Nutzers, und zwar auch dann, wenn sich der Inhalt bei näherer Betrachtung als nicht strafbar erweist“, so der DAV.
Bei den unter Bußgeldandrohungen verpflichtenden halbjährlich vorzulegenden Transparenzberichten der Anbieter müssen künftig u.a. Veränderungen gegenüber den letzten beiden vorherigen Berichten erläutert werden.
Auch muss in den Transparenzberichten aufgeführt werden, ob und inwiefern die sozialen Netzwerke unabhängigen Forschungseinrichtungen Zugang zu anonymisierten Daten für wissenschaftliche Zwecke gewähren. Dadurch könnten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen systematische Analysen durchführen und tiefergehende Erkenntnisse dahingehend erlangen, welche Personengruppen – und in Bezug auf welche Eigenschaften – besonders häufig das Ziel rechtswidriger Inhalte im Netz sind und inwiefern abgestimmte und koordinierte Verhaltensweisen von Verfasserinnen und Verfassern rechtswidriger Inhalte vorliegen.
Google kritisierte diese verklausulierte Auflage in einer Stellungnahme: Das „Nachhalten solcher Informationen über Opfer und Täter“ setze voraus, dass die Betreiber „eine umfassende Überwachungsstruktur in Bezug auf das Nutzerverhalten installieren“.
Die Anbieter müssten nicht nur „Daten zum Nutzerverhalten“ sammeln, sondern dieses auch umfangreich auswerten, monierte Google. Facebook gab ebenfalls zu bedenken, dass die neuen Transparenzauflagen „ohne weitreichende neue Datenerhebungen und -auswertungen in einem sehr sensiblen Bereich (beispielsweise ethnische oder religiöse Zugehörigkeit oder politische Gesinnung) nicht umsetzbar“ seien.
Regierung und Medien stellten die Einführung eines „Gegenvorstellungsverfahren“ im Gesetzentwurf groß heraus. Angeblich soll damit die Gefahr des Overblockings verringert werden. Die Betreiber werden dazu verpflichtet, auf Antrag eines Mitglieds ihre Entscheidungen zum Löschen oder Beibehalten von Beiträgen zu überprüfen und das Ergebnis gegenüber dem Betroffenen „in jedem Einzelfall zu begründen“.
„Das Gegenvorstellungsverfahren soll als Art schiedsgerichtliches Verfahren zwischen Dienstanbieter, Betroffenem und dem Inhalte einstellenden Nutzer (auch ‚Uploader‘ genannt) geführt werden“, schreibt Google dazu. „Erneut verlagert das Gesetz damit jedenfalls faktisch staatliche Aufgaben mit in alle Richtungen nachteiligen Effekten auf Private. Zu nennen ist hier vor allem das erhebliche Risiko für Betroffene“, dass ihre Identität im Rahmen des Ansatzes erkennbar werde.
„Selbst bei Anonymisierung der personenbezogenen Daten des Betroffenen [was das Gesetz vorschreibt] kann die vollständige Anonymität nicht gewährleistet werden“, erklärte Google. Der Antragsteller laufe Gefahr, „dass möglicherweise gewaltbereite, rechtsextreme Gruppierungen ihn identifizieren können“. Ähnliche Risiken bestünden für Personen des öffentlichen Lebens wie Politiker oder Journalisten, „die aufgrund ihres Bekanntheitsgrads erkennbar bleiben“. Dafür müssen sie die Gegenvorstellung „nicht einmal selbst eingereicht haben“.
Die künftige polizeiliche Zentraldatenbank würde auch über das hinausgehen, was bisher die heftig umstrittene Vorratsdatenspeicherung wollte: private Kommunikation Ermittlern unfreiwillig preisgeben. Bei der Vorratsdatenspeicherung ging es nämlich bei einem Verdacht einer konkreten schweren Straftat nur um sogenannte Verkehrsdaten, die der Telefonanbieter ausschließlich bei sich länger speichern sollte: also wer, wann und wo mit wem telefoniert hat. Um den Inhalt der Gespräche ging es dabei nicht. Gleichwohl haben das Bundesverfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof die Vorratsdatenspeicherung bislang stets abgelehnt.
Die Gesetzesverschärfungen stellen einen massiven Angriff auf demokratische Grundrechte dar. Mit dem angeblichen Kampf gegen Rechtsextremismus, den die Bundesregierung als Vorwand nimmt, hat er nichts zu tun. Tatsächlich haben alle Parteien im Bundestag die rechtsradikale AfD von Anfang an systematisch legitimiert und eingebunden, und die Polizei- und Geheimdienstbehörden sind von rechtsextremen Netzwerken durchsetzt.