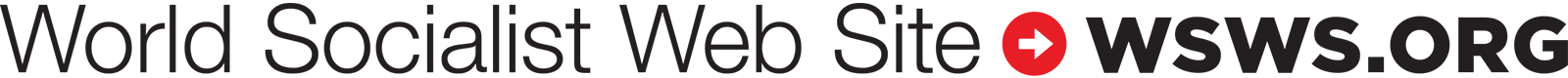Auch in der Schweiz hat sich die Regierung der aggressiven „Back-to-work“-Kampagne angeschlossen. Im Interesse der Wirtschaft und des Finanzplatzes Schweiz setzt sie die Gesundheit und das Wohlergehen der arbeitenden Bevölkerung aufs Spiel.
Am Donnerstag, dem 16. April, gab Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (SP) die Lockerung des Pandemieschutzes bekannt. Der Bundesrat (die Schweizer Regierung) werde „in Etappen vorgehen“. Schon am 27. April darf ein großer Teil der Geschäfte, Gärtnereien, Friseur-Salons, Baumärkte, etc. den Betrieb wieder aufnehmen, während der lukrative Bausektor bisher von Schließungen ganz verschont war. Ab dem 11. Mai sollen dann auch Hochschulen, Museen und Bibliotheken wieder öffnen.
Eine „gute Nachricht“ sei das, die „uns allen eine Perspektive“ böte, so die SP-Bundesrätin. Eine gute Nachricht ist es jedoch vor allem für die Profite der Banken und Privatvermögen. Ihrem Druck sind die Beschlüsse in erster Linie geschuldet. Auch die rechte Blocher-Partei SVP forderte seit Wochen vehement, dass die Wirtschaft wieder anlaufen müsse. Begleitet wird die Kampagne durch eine haarsträubende öffentliche Diskussion über Ethik und Eugenik. Dabei zitierte die Neue Zürcher Zeitung zustimmend Friedrich den Großen, wie er seinen Soldaten zurief: „Wollt ihr denn ewig leben?“
Auf wissenschaftliche Einsicht und belastbare Ergebnisse stützt sich die Allparteienregierung dagegen nicht. Nach wie vor steigen die Fallzahlen bedenklich an. Betrachtet man die Zahlen pro Einwohner, steht die Schweiz an der Spitze der Pandemie und nimmt direkt hinter Spanien den zweiten Platz in Europa ein. Am Montagmorgen, den 21. April, registrierte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gemeinsam mit dem Fürstentum Liechtenstein 204 bestätigte Neuinfektionen innerhalb eines einzigen Tages. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten beläuft sich auf rund 28.000 Fälle.
Schlimm ist die Lage in den Seniorenheimen, Flüchtlingsunterkünften und Gefängnissen und überall dort, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenleben. Leicht entwickeln sie sich zu Hotspots der hochansteckenden Krankheit, auch wenn darüber wenig an die Öffentlichkeit dringt. Etwa die Hälfte aller Corona-Toten sind Senioren, die sich in einem Pflegeheim angesteckt haben. Hier wird der brutale Charakter der offiziellen Politik sehr deutlich.
Der Kanton Bern hat beschlossen, dass akut Erkrankte solange in den Heimen selbst behandelt werden sollen, bis sie schwere Komplikationen aufweisen. Die Pflegeheime müssen für die Beschaffung von Masken und anderen Schutzmitteln selbst sorgen.
Im nationalen Fernsehen SRF berichtete Katrin Bucher, die Geschäftsführerin des Senioren- und Pflegezentrums Schönberg (Stadt Bern), über ein Schreiben des kantonalen Gesundheitsdirektors: „Er schrieb uns, dass wir unsere Bewohner nicht mehr hospitalisieren sollen. Aber er schrieb auch, dass sämtliche Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie in der Verantwortung der Institutionen liegen würden, und dass wir dafür keine zusätzlichen Ressourcen erhalten.“ Da habe sie schon sehr schlucken müssen, denn leicht könne sich „eine richtige Tragödie entwickeln“, so Frau Bucher.
Aus der Zürcher Notunterkunft für geflüchtete Familien in Adliswil wurde am 9. April bekannt, dass sich schon mindestens drei Familien infiziert hatten. Die Behörden haben die Pandemiebekämpfung zum Vorwand genommen, um die Unterkünfte polizeilich abzuriegeln, doch nur zögernd ließen sie die Infizierten nach Tagen aus den Einrichtungen abholen.
Über die Flüchtlingsunterkunft Urdorf (Kanton Zürich) berichtete die Wochenzeitung (WoZ), dass dort etwa 40 Männer in einem Bunker hausen müssten. Dort müssten sich sechs bis zehn Personen die zwölf Quadratmeter großen Räumen teilen, und es gebe weder Tageslicht noch frische Luft: „Wie kann man da Abstand halten?“ so die Frage eines verzweifelten Bewohners.
Es kann jedoch jeden treffen, der oder die nicht die Möglichkeit hat, sich bei der Arbeit zu schützen, im Heim-Office zu arbeiten oder sich in sichere Quarantäne zurückzuziehen.
Loganathan Sathasivam war 59 Jahre alt, als er am 26. März einsam in seinem Appartement in Jona, St. Gallen, starb. Die Staatsanwaltschaft teilt mit: „Todesursache war ein viraler Infekt, konkret der Corona-Virus.“ Obwohl Diabetiker und als solcher Hochrisikopatient, hatte die Hausarztpraxis den positiv mit Covid-19 Getesteten nach Hause geschickt. Nur im Falle einer Verschlechterung könne er in ein Krankenhaus eingewiesen werden. Genau diese Verschlechterung trat denn auch ein
Wie ein junger Nachbar dem News-Portal TeleZüri berichtete, habe er selbst die Praxis angerufen und Alarm geschlagen: „Ich sagte ihnen, dass Loganathan einen schlimmen Husten habe – das war nicht normal, sondern wirklich schlimm.“ Doch man habe ihm bloß gesagt, er solle ihm einen Sirup besorgen. Kurze Zeit später war Loganathan tot. Sein Bruder, der ihn tot in der Wohnung aufgefunden hatte, alarmierte die Öffentlichkeit, „damit das keinem anderen mehr passiert!“ Von der Arztpraxis gab es bisher keine Stellungnahme.
Loganathan Sathasivam ist nur einer der vielen Hundert, die in der Schweiz bereits an Covid-19 gestorben sind. Seit dem 5. März, als das erste Corona-Todesopfer (eine 74-jähige Frau) im Universitätsspital Lausanne starb, ist die Zahl der Verstorbenen in knapp sieben Wochen auf über 1400 angestiegen. (Europaweit sind schon über 100.000 Menschen am Coronavirus gestorben.) In der Schweiz sind es vor allem die südlichen Grenzkantone Waadt (292 Tote), Tessin (288 Tote) und Genf (193 Tote), die eine traurige Spitzenposition bei den Todesopfern einnehmen. Im Tessin wurden allein am letzten Sonntag wieder sieben Todesfälle gemeldet. Pro 10.000 Einwohner sind dort 86,5 Personen an Covid-19 erkrankt.
Als die Pandemiezahlen stiegen, sah die Tessiner Kantonsregierung sich gezwungen, am 23. März den Notstand auszurufen. Von dem Lockdown waren zunächst auch die drei Tessiner Goldraffinerien Argor-Heraeus, Valcambi und PAMP betroffen. Die Arbeiter dieser Raffinerien, die zu den größten der Welt gehören, sind zu zwei Drittel Grenzgänger aus Italien.
Allerdings war der Druck aus der Wirtschaft und Finanzwelt enorm. Da Gold als Krisenwährung par excellence gilt, ist seit der Ausbreitung der Pandemie die Nachfrage nach Gold sprunghaft angestiegen, und der Goldpreis hat mit über 1.600 Dollar die Unze ein Sieben-Jahres-Hoch erreicht. So machte der Bundesrat die Entscheidung des Tessiner Kantonsrats rasch wieder rückgängig, und die Grenze wurde für Schweizer Bürger und Italiener mit Arbeitsausweis fast überall wieder geöffnet. Schon in der ersten Aprilwoche nahmen alle drei Goldraffinerien die Arbeit zu 50 Prozent wieder auf.
Dass die Herstellung von Goldbarren so rasch als eine „systemrelevante“ Produktion eingestuft wird, während die Herstellung von Schutzmaterialien, Desinfektionsmitteln und Testkits auf der Strecke bleibt, muss zu denken geben. Welchen Preis die Beschäftigten dafür bezahlen, und ob es bereits Arbeiter darunter gibt, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, ist bisher unbekannt.
In jedem Fall zeigt das Beispiel, dass die „etappenweise Lockerung“ darauf hinausläuft, Tausende Arbeiter und Angestellte zurück an die Arbeit zu schicken, ohne dass ihnen in ausreichendem Maß Masken, Handschuhe, Desinfektion und die Möglichkeit auf Selbstschutz gewährt wird. Angesichts der wenigen Testmöglichkeiten kann sich niemand darauf verlassen, dass die Kollegen nicht unwissentlich das Virus in sich tragen. Bisher hatten kaum 2,5 Prozent der Einwohner die Möglichkeit, sich auf Covid-19 testen zu lassen.
Besonders betroffen sind natürlich die Ärzte und Pflegekräfte. Darüber berichtete die Ärztin Sabine Popescu aus Verbier im Wallis. Verbier ist ein prominenter Skiort, der ähnlich wie das österreichische Ischgl schon früh eine große Zahl an Infizierten aufwies und drohte, zur Virenschleuder zu werden. Schon am 23. März hatte Frau Popescu deshalb mit anderen Ärzten zusammen gefordert, das Val de Bagne, in dem Verbier liegt, komplett abzuriegeln. Doch die Walliser Behörden hatten gemeinsam mit dem BAG anders entschieden.
Am 3. April sagte die Ärztin der Zeitung L’Illustré, sie fühle sich verzweifelt und machtlos. Zwar seien Touristen und Saisonarbeiter abgereist, aber „bei einer so hohen Rate von Infizierten hätte die Quarantäne ausgesprochen werden müssen. Unseren Behörden fehlte es an Voraussicht … In Bern scheinen sie die Dringlichkeit der Situation nicht zu verstehen.“
Die Ärztin berichtete, dass sie bis Mitte März „weder die Tests noch das Recht, sie durchzuführen“ gehabt habe. Sie habe Patienten, vor allem Touristen, zur Untersuchung nach Sion, ins Tal hinunter, schicken müssen. Noch immer arbeite sie mit improvisierter Schutzausrüstung, in einem Heimwerkeranzug und ohne ausreichenden Mundschutz.
Nur einmal jeden Tag könne sie ihre Maske wechseln, so die Ärztin. „Uns fehlt es an Masken, an Reagenzien für die Tests, etc. Da sehen wir, dass Asien vor der Schweiz und vor Europa liegt. Hätten wir Millionen von Einwohnern, dann wäre unser Land am stärksten kontaminiert.“
Mittlerweile erlebe sie in ihrer Arztpraxis in Verbier, dass 70 bis 75 Prozent der Patienten Covid-19-positiv getestet würden. Je nach Tag und Auswahl der Patienten könnten es auch leicht 100 Prozent werden. Zum Glück sei bisher noch keiner gestorben, doch mehrere lägen im Krankenhaus und würden künstlich beatmet. Die Behörden müssten doch alles zu tun, um eine Situation zu vermeiden, bei der – wie in einigen Regionen in Großbritannien oder im Elsass – die über 70-Jährigen von den Beatmungsgeräten ausgeschlossen würden.
Das sei eine „furchtbare ethische Entscheidung für einen Arzt“, so Popescu. „Schicke ich meine älteren Patienten ins Krankenhaus, wenn sie Atembeschwerden haben, oder nicht? Wenn sie positiv sind, kann man ihnen doch nicht sagen: ‚Warten Sie ab, ob sich Ihr Fall verschlechtert, aber dann werden Sie leider kein Beatmungsgerät bekommen‘.“
Der Beitrag eines weiteren Arztes kursiert derzeit in den Medien. Der Kardiologe Prof. Paul Robert Vogt hatte selbst jahrelang in Asien gearbeitet. Er kritisiert das Niveau der medialen Berichterstattung und Kommentare „in Bezug auf Fakten, Moral, Rassismus und Eugenik“. Notwendig sei ein auf zuverlässige Daten und Fakten gestützter Widerspruch, argumentiert Prof. Vogt.
Ausdrücklich bezeichnet er den Umgang der Schweiz mit Corona als „Schande“, in Anbetracht der Tatsache, dass das Land 85 Milliarden für sein Gesundheitswesen zur Verfügung hat. Nach „14 Tagen lauem Gegenwind“ stehe die Schweiz an der Wand, verfüge über „zu wenig Masken, zu wenig Desinfektionsmittel und zu wenig medizinisches Material“. Sein Fazit: „Hätte man die medizinischen Fakten zur Kenntnis genommen, und wäre man fähig gewesen, Ideologie, Politik und Medizin zu trennen, wäre die Schweiz heute mit großer Wahrscheinlichkeit in einer besseren Lage.“
Tatsächlich ist es in keiner Weise ein Zufall, dass die Schweizer Regierung auf das Virus derart schlecht vorbereitet war. Was die fehlenden Bestände an Desinfektionsmittel angeht, so trägt die Privatisierungsorgie der letzten Jahre daran eine große Mitschuld.
Vor zwei Jahren hatte das zuständige Bundesamt beschlossen, den nationalen Katastrophenvorrat an Ethanol aufzulösen. Fast 80 Jahre lang hatte die Schweiz Tausende Tonnen Ethanol zur Herstellung von Desinfektionsmitteln gelagert. Doch im Jahr 2018 gab der Bund, wie es in einem Bericht der Tamedia-Gruppe heißt, im Zusammenhang mit der Privatisierung der Eidgenössischen Alkoholverwaltung eine Notreserve von 10.000 Tonnen Ethanol „still und heimlich“ auf. Kein Wunder, dass die Vorräte in den Apotheken rasch erschöpft waren, als Ende Februar die Pandemie auch die Schweiz erreichte.