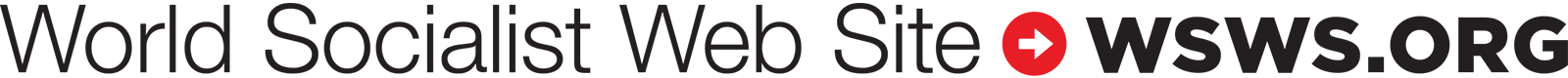Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will den Streik bei den beiden großen Berliner Klinikkonzernen Charité und Vivantes noch bis zum Freitag weiterlaufen lassen, um ihn dann abzuwürgen und auszuverkaufen. Das ist die Schlussfolgerung aus der Pressekonferenz, auf der Verdi am Mittwochvormittag über den Verlauf des Arbeitskampfs informierte.
Bei den Tochterfirmen von Vivantes, bei denen es um die Angleichung der äußerst niedrigen Löhne an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) geht, bricht Verdi den Streik am Samstag ab. Obwohl das Angebot von Vivantes „völlig unzureichend“ ist, wie Gewerkschaftssekretär Ivo Garbe zugab, nimmt die Tarifkommission von Verdi am Samstag wieder Verhandlungen auf und setzt den Streik bis mindestens Montag aus.
Das äußerst vage Angebot von Vivantes sieht erst in sieben Jahren eine Angleichung der Löhne an den TVöD vor. Statt um 35 Millionen, die nach Angabe von Personalchefin Dorothea Schmidt zur Erfüllung der Tarifforderung nötig wären, sollen die Ausgaben für Löhne im kommenden Jahr nur um fünf Millionen Euro erhöht werden.
Melanie, die für die Vivantes-Tochter MVZ (Medizinisches Versorgungszentrum) arbeitet, erläuterte, dass das neue Angebot für viele sogar eine Gehaltssenkung bedeute. Da keine Eingruppierungen der Beschäftigten nach Arbeitsjahren, Erfahrung oder Ausbildung vorgesehen sei, würde sie selbst einen Nettolohnverlust von 600 Euro erleiden. Bei der Angleichung an den TVöD würde ihr Gehalt dagegen um monatlich 800 Euro steigen.
Dass Verdi den Streik trotzdem abbricht, ist ein klares Signal der Kapitulation – nicht nur in Bezug auf die Vivantes-Tochterfirmen, sondern auch auf das Mutterhaus und auf die Charité. Auch hier sei Verdi bereit, den Streik einzuschränken, wenn es neue Angebote gebe, versprach Verhandlungsführerin Meike Jäger auf der Pressekonferenz. Charité-Chef Heyo Krömer hat Verdi für Samstag bereits ein Spitzengespräch angeboten.
Verdi reagiert mit dem Abwürgen des Streiks auf die wachsende Mobilisierung der Pflegekräfte, die sich wie ein Lauffeuer ausbreitet. Der Arbeitskampf bei den beiden landeseigenen Klinikkonzernen wird von vielen als Signal verstanden, endlich gegen die unerträglichen Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen vorzugehen, die durch jahrelange Kürzungen, Privatisierungsmaßnahmen und Profitorientierung entstanden sind und durch die Corona-Pandemie weiter verschärft wurden
Seit der Streik am Donnerstag letzter Woche begann, kam es täglich zu Kundgebungen und Demonstrationen, auf denen die Streikenden ihrem Ärger Luft machten. Die Zahl der Streikwilligen stieg von Tag zu Tag.
Die Kampfbereitschaft blieb nicht auf Berlin beschränkt. Gestern sah sich Verdi gezwungen, auch die Beschäftigten der psychiatrischen Kliniken von Asklepios in Brandenburg zu einem mehrtägigen Warnstreik aufzurufen. Auch in Polen, dessen Grenze keine 100 Kilometer von Berlin entfernt liegt, gibt es Massenproteste von Krankenhausbeschäftigten – was von den deutschen Medien und von Verdi sorgsam verschwiegen wird.
Von der WSWS auf die Proteste in Polen und eine Ausdehnung des Streiks angesprochen, musste Verdi-Funktionärin Jäger zugeben, dass es schwierig sei, die Streikenden zu bremsen.
„Ich kann nur sagen, dass die Stimmung unter den Streikenden, die im Streik sind, die streiken wollen, dass die ziemlich sauer sind, dass die Arbeitgeberseite sich so wenig bewegt,“ sagte sie. „Deswegen ist es natürlich auch für uns, gerade auch für mich als Verhandlungsführerin, schwierig, die Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen, dass man jetzt auf die Arbeitgeberseite entgegengeht und was anbietet mit Blick auf den Streik, wenn wir nicht einmal wissen, was da drin ist in dem Sack.“
Jäger ist sich auch bewusst, dass der Streik bei den beiden größten deutschen Klinikkonzernen weit über Berlin hinaus Vorbildcharakter hat. Sie wisse „von ganz vielen Krankenhäusern, bundesweit“, die sich auch auf den Weg machten, ähnliches zu diskutieren, sagte sie.
Doch eine große Streikbewegung während der Bundestagswahl und der Berliner Abgeordnetenhauswahl, die zeitgleich am 26. September stattfinden, ist das letzte, was Verdi will. Sie könnte der Kontrolle der Gewerkschaft leicht entgleiten und sich gegen die Senatsparteien – SPD, Linkspartei und Grüne – wenden.
Gerade in Berlin, wo die SPD seit mehr als zwanzig Jahren regiert, die größte Zeit davon im Bündnis mit der Linkspartei, hat das Kartell von Senat und Verdi dafür gesorgt, dass die Kliniken kaputtgespart und auf Profit orientiert wurden – und sie werden das auch weiterhin tun. Sie haben längst aufgehört, die Arbeiter zu vertreten, und verteidigen die Interessen des Kapitals.
Meike Jäger verkörpert die Personalunion von Gewerkschaftsbürokratie, Politik und Profitinteressen, mit der die Beschäftigten des Gesundheitswesens zu kämpfen haben. Die diplomierte Soziologin, die fünf Jahre an der Frankfurter Goethe-Universität studierte, ist stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von Vivantes und Mitglied des Aufsichtsrats der Rhön-Klinken, eines der größten privaten Klinikbetreiber in Deutschland. Sie ist außerdem Vorstandsmitglied der Linkspartei-nahen Rosa Luxemburg Stiftung.
Von der WSWS auf ihre Doppelrolle als Verhandlungsführerin der Gewerkschaft und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von Vivantes angesprochen, gab sie zu: „Es ist manchmal nicht einfach, die Rollen auseinanderzuhalten. Man hat ja zwei Hüte auf dem Kopf.“
SPD, Linkspartei und Grüne sind sichtlich nervös über den Streik bei den landeseigenen Kliniken. Sie spielen ein übles Schmierentheater mit verteilten Rollen. Ihre Spitzenkandidaten heucheln öffentlich Solidarität und sprechen auf Streikversammlungen, während die zuständigen Senatoren und die von ihnen ernannten Geschäftsführer jedes Zugeständnis blockieren, die Streikenden erpressen und ihnen mit Regressforderungen drohen.
Der Aufsichtsratsvorsitzende von Vivantes, Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), lehnt Forderungen nach einem finanziellen Entgegenkommen des Senats und entsprechenden Anweisungen an die Geschäftsführung strikt ab: „Um es klar zu sagen: Dies sieht das Finanzierungsprinzip von Plankrankenhäusern in Deutschland nicht vor – und ist auch nicht vereinbar mit dem Wettbewerbsrecht.“
Die Sozialistische Gleichheitspartei (SGP), die zur Bundestagswahl und zur Berliner Abgeordnetenhauswahl mit eigenen Landeslisten antritt, tritt dafür ein, unabhängige Aktionskomitees aufzubauen, in denen die Beschäftigten selbst und nicht die Verdi-Funktionäre das Sagen haben.
Die Aktionskomitees müssen sicherstellen, dass Verdi keinen Abschluss ohne Zustimmung der Streikenden unterschreibt. Sie müssen Verbindungen zu den Kollegen in anderen Kliniken und Betrieben aufnehmen, um – über Länder und nationale Grenzen hinweg – eine gemeinsame Offensive zu organisieren. Das erfordert eine sozialistische Perspektive, die die gesellschaftlichen Bedürfnisse über die Profitinteressen stellt.