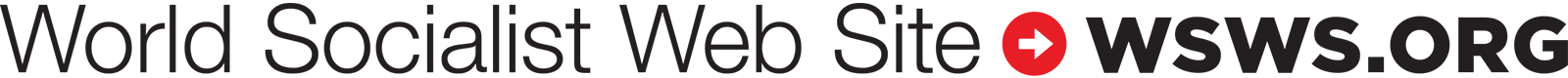Anlässlich des 50. Jubiläums der Sektion Forum zeigte die diesjährige Berlinale einige Filme über die militanten Arbeiterkämpfe der 1970er Jahre. Dazu gehörten Filme von Chris Marker und der Gruppe Medvedkine Sochaux in der Peugeot-Fabrik, die im Juni 1968 von Arbeitern besetzt wurde.
Seit Anfang der 90er Jahre, nach der Auflösung der Sowjetunion, spielte die Arbeiterklasse in der Filmszene kaum mehr eine Rolle. Die Beschäftigung mit individuellen Beziehungen in den Mittelschichten stand im Zentrum, der Klassencharakter der Gesellschaft fand nur beschränkt Eingang in die filmische Arbeit und wenn, dann wurden Protagonisten aus dem Arbeitermilieu oftmals nur als „sozial Schwache“ und Opfer von Ungerechtigkeit gezeigt.
Diese Sicht beginnt sich zu verändern. In diesem Jahr gab es etliche Filme vor allem von jüngeren Regisseuren, in denen Arbeiter und ihre Familienangehörigen Hauptpersonen und Akteure sind, die trotz der Düsterkeit ihrer Lebensverhältnisse Selbstbewusstsein, Stolz und ein beginnendes Aufbegehren zeigen. Dabei bleiben Regie und Filmkamera nicht auf Distanz, sondern nehmen Anteil an ihrem Leben.
Die WSWShat bereits über Kids Run von Barbara Ott und Jetzt oder morgen von Lisa Weber geschrieben. Man könnte auch Garagenvolk von Natalija Yefimkina und Automotive von Jonas Heldt nennen, oder den deutsch-amerikanischen Film One of these days von Bastian Günther und den serbischen Film Otac von Srdan Golubovic. In dieser Besprechung geht es um einen französischen Beitrag und einige Kurzfilme, die wohl kaum in deutschen Kinos zu sehen sein werden.
Grève ou crève – Streik oder Tod, von Jonathan Rescigno, Frankreich
„Streik oder Tod“, Grève ou crève – heißt der französische Dokustreifen von Jonathan Rescigno. Geboren 1980 im französischen Forbach im lothringischen Bergbaugebiet nahe der deutschen Grenze und selbst Enkel eines Bergmanns, stellt der Regisseur in seinem ersten abendfüllenden Film zwei Generationen gegenüber, für die das Leben von harten Kämpfen erfüllt war und heute wieder ist.
Im Mittelpunkt des Films steht der Boxclub. Junge Männer und Frauen lassen sich hier vom ehemaligen Bergmann Toumi trainieren. Sie schwitzen, gehen an die Grenze ihrer Muskelkraft und ertragen es, wenn sie Toumi unflätig anschreit, sie seien „wohl ein Leben lang nur gepampert“ worden. Derselbe raue Trainer wird unmittelbar vor dem Boxturnier ganz sanft, spricht seinen jungen Zöglingen fast liebevoll Mut zu: „Keine Sorge, ihr seid nicht allein!“ Es ist die alte Solidarität in neuer Zeit.
Der Boxclub ist für Jonathan Rescigno eine Metapher für das Zusammentreffen der Generationen von gestern und heute. Auch die heutige Jugend bereite sich auf einen „Kampf mit Leib und Seele“ vor, auf eine Rebellion gegen eine ungerechte Welt und für eine würdige Zukunft.
Hautnah porträtiert er die jetzigen Bewohner seiner Stadt. Er begleitet zwei Jugendliche aus Migrantenfamilien, einer davon Sohn eines Bergmanns. Auch er lässt sich letztlich von Toumi trainieren. Die beiden Freunde streifen durch die Stadt mit den stillgelegten Fördertürmen, treffen Freunde auf dem Straßenfest, diskutieren über die unsichere Zukunft und treffen dabei mit der Vergangenheit zusammen.
Bisher unveröffentlichte Videoaufnahmen von Dezember 1995 erinnern an einen heftigen Streik der Bergleute in Forbach gegen die Kürzung ihrer Rentenansprüche. Über tausend Arbeiter mit Spitzhacken, Schaufeln und Bolzen rennen durch die Straßen, werden von der französischen Polizei gejagt und zusammengeschlagen. Tränengaswolken liegen über der Szenerie. Jonathan Rescigno erinnert sich, wie er und seine Freunde damals selbst durch die vernebelten Straßen liefen und nicht wirklich verstanden, was auf dem Spiel stand. Was ihm jedoch in Erinnerung geblieben ist, „sind die Energie der Massen und die Entschlossenheit des Volks“.
Ein alter Bergmann zeigt einer Besuchergruppe voller Stolz Fotos von damals, sowie einen Grubenhelm, auf dem die einzelnen Ereignisse und Streiktage notiert sind. Ein Ehepaar streitet, nachdem der Mann nach einem Arbeitsunfall auf dem Bau entlassen wird und nun vergeblich um eine Arbeitsunfähigkeitsrente kämpft. Die Frau, die aus einer Bergarbeiterfamilie stammt, wirft ihrem Mann mangelnden Kampfgeist gegen den Bauunternehmer vor und vergleicht dies mit vergangenen Bergarbeiterkämpfen: „Wenn ich Du gewesen wäre, hätte ich den Chef am Kragen gepackt“. Er sei verantwortlich für den Unfall, der tödlich hätte enden können. „Dafür müsste er ins Gefängnis“, schimpft sie. „Ich hätte ihm das klargemacht. Er soll sich schon mal einen Anwalt nehmen …“
Die junge Generation hat von den Kämpfen ihrer Eltern und Großeltern keine Ahnung. Das offizielle Bergbaumuseum der Stadt, das die beiden Jugendlichen besuchen, verzerre das Bild, sagt Regisseur Rescigno. Die ehemaligen Arbeitgeber, die das Museum errichtet haben, hätten kein Interesse, die „gefährlichen Arbeitsbedingungen“ und die manchmal blutig erkämpften „Siege der Arbeiter“ zu zeigen.
Wenn die beiden Jungen das Museum besuchen und halb kichernd, halb verwundert alte Fotos anschauen, hört man im Hintergrund eine Lautsprecherstimme, die die sozialen Fortschritte für Bergleute preist. Stimmt das, fragen sie den Museumsführer, haben die Bergleute jemals einen gerechten Lohn für diese gefährliche Arbeit erreicht. Nein, sagt dieser. Aber sie hätten früher sehr lange gestreikt. Heute, fügt der ehemalige Bergmann lapidar hinzu, gebe es höchstens einmal zwei Stunden Arbeitsniederlegung zwischen 6 und 8 Uhr.
Dies ist bezeichnenderweise der einzige Hinweis auf heutige Gewerkschaftsaktionen. Im Unterschied zu den Filmen vor 50 Jahren werden Gewerkschaften oder auch Parteien wie die französische Kommunistische Partei nicht mehr als Vertreter der Arbeiter gesehen.
Trotz ihrer Unwissenheit über vergangene Kämpfe seien „Kampfgeist und Entschlossenheit in das kollektive Unbewusste eingeschrieben“, meint Rescigno.
Allerdings sind bewusst gezogene Lehren aus vergangenen Kämpfen und aus der Degeneration der alten Arbeiterorganisationen gerade für die neue Generation wichtig. Grève ou crève von Jonathan Rescigno lässt diese Frage offen, könnte aber dafür einen Anstoß geben.
Berlinale Shorts: Filipiñana (Philippinen), Union County (USA), Huntsville Station (USA)
Den Silbernen Bären der Jury für Kurzfilm hat Filipiñanades philippinischen Regisseurs Rafael Manuel (30 Jahre) erhalten. Mit seinem jungen philippinisch-britischen Filmteam, das die Gelder für die Produktion teilweise über Internet eingesammelt hat, befasst sich Manuel auf erfrischende Weise mit der extremen sozialen Ungleichheit, die nicht nur die Philippinen betrifft. Ort des Geschehens ist ein exklusiver Golfplatz, für Manuel ein Mikrokosmos, der die gesellschaftlichen Zustände widerspiegelt.
Isabel (Jorrybell Agoto) heuert hier als „Tee Girl“ an. Tee-Girls sammeln die Golfbälle ein, fischen sie aus den mit Seerosen bedeckten Tümpeln, waschen, sortieren sie und legen sie den Golfern zurecht. Manchmal müssen sie den Ehegattinnen der Golfer die Füße massieren. Dafür werden sie mit Dumping-Löhnen abgespeist. In der Mittagshitze schlafen sie zusammengepfercht auf dem Boden der Garderobe, eine Managerin sorgt für die Disziplinierung der Mädchen und sitzt dabei im Verwalterbüro, wo sie sich mit Kuchen fett frisst.
„Im Golfmilieu prallen die verschiedenen sozialen Klassen der philippinischen Gesellschaft aufeinander und enthüllen eine alltägliche Gewalt, die sich als normal und bürgerlich etabliert hat“, sagt Rafael Manuel zu seinem Film.
Wenn Isabel den ganzen Tag auf einem niedrigen Hocker im Staub sitzt und stoisch den Golfern die Bälle reicht, sehen wir ihr Gesicht in Großaufnahme. Sie schaut in unsere Richtung, während die Schläger bedrohlich knapp vor ihrem Gesicht vorbeischwingen. „Alltägliche Gewalt“ hautnah, man duckt sich unwillkürlich.
Aber Isabel lässt sich nicht zur unterwürfigen Sklavin degradieren. Sie legt sich auf die Wiese, obwohl dies nur den Gästen des Clubs erlaubt ist, nascht von einer Torte auf dem Empfangstisch für eine Golfergesellschaft, und setzt sich an einen von deren Tischen. Als am Abend in der Bar die Mädchen die Gäste durch Gesang erheitern sollen, singt Isabel das Lied vom armen Fischer.
Isabel ist „der stille Sand im Getriebe des satten Grüns“, heißt es blumig im Berlinale-Programm. Sie wehrt sich gegen eine kapitalistische Elite, die der Arbeiterklasse das Recht auf Leben und Glück abspricht. Das will sie nicht akzeptieren.
Am Ende sieht man Isabel in der Ferne, mitten auf dem Feld des riesigen, grünen Golfplatzes, wo sie einen wilden Freudentanz vollführt.
In Union County von Adam Meeks muss Cody (Zachary Zamsky), der junge Arbeiter einer Holzfabrik in Ohio, in seinem Auto wohnen. Dort stöbert ihn seine einstige Freundin auf und verbringt die Nacht mit ihm auf der Rückbank. Am nächsten Morgen verlässt sie ihn, ihre Knie zittern und verraten die Drogensucht, sie braucht neuen Stoff. Man erfährt bei Codys Termin im Sozialamt, dass er selbst erst seit 45 Tagen clean ist. Weil er seitdem auch keinen Alkohol zu sich nimmt und Arbeit hat, stellt ihm die Sozialbearbeiterin einen Wohnplatz in einer betreuten Einrichtung in Aussicht, aber nicht sofort. Eine ältere Frau neben ihm hat trotz Beteuerung, sie werde sich noch am selben Tag für eine Putzstelle bewerben, weniger Glück.
Man sieht den jungen Mann wieder in seinem Auto, als am Morgen seine Freundin zurückkehrt. Doch dieses Mal öffnet er die Autotür nicht. Sie schreit immer lauter und tritt gegen das Auto. Sein Gesicht färbt sich rot, verkrampft sich, die tränenerfüllten Augen treten hervor – die Spannung schmerzt und ist kaum zu ertragen. Der Zuschauer wird mit dem unbestimmten Gefühl entlassen, dass sich diese Spannung irgendwann, vielleicht bald und als Teil eines kollektiven Ausbruchs entladen wird.
Ähnlich verhält es sich mit Huntsville Station von Jamie Meltzer und Chris Filippone. Ihr Kurzfilm richtet den Focus auf die überfüllten amerikanischen Gefängnisse, in die Millionen wegen kleiner Delikte aufgrund ihrer Armut eingesperrt werden.
Das größte Staatsgefängnis von Texas, das Huntsville State Penitentiary, entlässt Dutzende Insassen für einen Hafturlaub, mit einem Gutschein für ein Busticket und einem 100-Dollar-Scheck. Der Film beobachtet einfühlsam die unterschiedlichen Charaktere während ihrer Wartezeit an der Greyhound-Station, einem Moment zwischen Gefangensein und Freiheit. Einige telefonieren mit Angehörigen, andere kaufen von fliegenden Händlern ein kleines Geschenk oder hängen ihren Gedanken nach. Einzelne bleiben auch zurück. Niemand wartet auf sie, am Ende gehen sie wieder in die Haftanstalt, eine Reinigungskraft sammelt ein paar Zigaretten und auf dem Boden liegende Bustickets ein.
Die Kamera fängt Gesichter von normalen Menschen ein, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Hautfarbe, Arbeitergesichter. Nur einen farbigen Häftling kann das Filmteam befragen. Er ist wortkarg und wiederholt nur einen Satz: „Ich muss hier noch 30 Jahre bleiben, verstehen Sie, dann bin ich ein alter Mann. Noch 30 Jahre …“ Am Ende rollen Tränen über sein Gesicht, und dem Zuschauer schnürt es die Kehle zu.