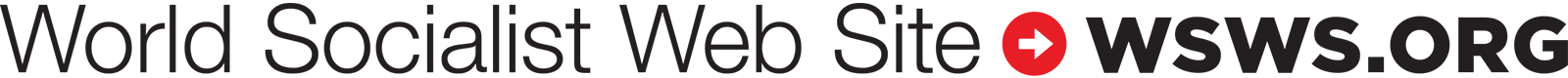Oskar Lafontaine, der Vorsitzende der SPD und Finanzminister der Regierung Schröder, ist am vergangenen Donnerstag unvermittelt von beiden Ämtern zurückgetreten und hat auch sein Bundestagsmandat niedergelegt. Sein aufsehenerregender Rückzug aus der Politik kennzeichnet einen tiefen Einschnitt in der politischen Entwicklung Deutschlands.
Lafontaine selbst gab in seinem kurzen Rücktrittschreiben an Bundeskanzler und Partei keinerlei Gründe für seinen Schritt an. Drei Tage lang war er für niemanden zu sprechen. Erst am Sonntag gab er vor der Presse eine kurze Erklärung ab, in der er seine Entscheidung mit dem "schlechten Mannschaftsspiel" innerhalb der Regierung begründete. "Wenn die Mannschaft nicht mehr gut zusammenspielt, muß man eine neue Mannschaftsaufstellung suchen. Dazu ist mein Schritt die Voraussetzung gewesen," sagte er, ohne jemanden persönlich für das "schlechte Mannschaftsspiel" verantwortlich zu machen.
Über die genauen Umstände, die Lafontaine zu seinem abrupten Rücktritt bewogen, gibt es zahlreiche Spekulationen. Sie reichen von einer Verschwörung im Kanzleramt, Lafontaine in der Öffentlichkeit zu demontieren, bis zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen Schröder und Lafontaine, nach dem letzterem nur noch die Möglichkeit geblieben sei "den Kanzler zu stürzen oder selbst den Bettel hinzuwerfen" ( Frankfurter Rundschau).
Sicher ist, daß Lafontaines politischer Kurs auf wachsenden Widerstand stieß und daß er auch in der eigenen Partei zunehmend an Unterstützung verlor.
Er galt als letzter führender Sozialdemokrat in Europa, der einer Politik des sozialen Ausgleichs das Wort redete. Dabei war er nur in einem sehr beschränkten Sinn ein "Linker" und mit Sicherheit kein Sozialist. Er war ein bürgerlicher Politiker, der - wie alle Sozialdemokraten - die Verteidigung der bestehenden Gesellschaftsordnung im Auge hatte. Oft stand er deshalb auch am rechten Flügel der Partei; so als er im Saarland das restriktivste Pressegesetz der Bundesrepublik einführte, um Kritik an seiner Regierung zu unterbinden.
Selbst der von ihm vertretene Wirtschaftskurs war nicht besonders links. Im Vergleich zur Finanzpolitik der Regierung Brandt, Schmidt oder selbst Kohl in den ersten Jahren ihrer Amtszeit nimmt sich jene Oskar Lafontaines eher konservativ aus. Er hat die im Rahmen von Maastricht gesteckten Ziele nie in Frage gestellt und in seinem ersten Haushaltsentwurf den Sparkurs seines konservativen Vorgängers systematisch weiterverfolgt.
Im Gegensatz zum Wirtschaftsflügel der SPD trat Lafontaine allerdings dafür ein, den negativen sozialen Auswirkungen der Globalisierung und dem ungehemmten Wirken des Marktes mit staatlichen Mitteln entgegenzutreten - und zwar sowohl im deutschen als auch im europäischen Rahmen. Im vergangenen Jahr legte er seine Auffassungen in dem Buch "Keine Angst vor der Globalisierung - Wohlstand und Arbeit für alle" dar, das er gemeinsam mit seiner Frau herausgab. Darin tritt er - im Gegensatz zur vorherrschenden angebotsorientierten Politik - unter anderem für eine Erhöhung der Einkommen zur Stärkung der Binnennachfrage ein.
Sein Rücktritt muß als Eingeständnis des Scheiterns dieser Politik gewertet werden.
Seine Vorstellungen trafen auf internationalen Widerstand, kaum hatte er im vergangenen Herbst die Leitung des Finanzministeriums übernommen. Ausgerechnet Dominique Strauss-Kahn, der Finanzminister der französischen Regierung, die Lafontaine angeblich politisch am nächsten stand, wischte schon beim ersten deutsch-französischen Treffen den Vorschlag brüsk vom Tisch, Zielzonen für die Wechselkurse der wichtigsten Weltwährungen einzurichten- sehr zur Freude der anwesenden Notenbanker.
Die britische Presse baute ihn zum Buhmann auf und bezeichnete ihn - auf der Titelseite des Boulevardblattes "Sun" - als "gefährlichsten Mann Europas".
Auf dem jüngsten G7-Treffen in Bonn machte dann der US-Finanzminister Robert Rubin unmißverständlich klar, daß die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt keine Eingriffe in den ungehemmten Fluß des Kapitals dulden werde: Wer stabile Wechselkurse wolle, belehrte er Lafontaine, dürfe nicht an ihnen herummanipulieren, sondern müsse bei sich zu Hause für gesunde volkswirtschaftliche Strukturen und eine vernünftige Wirtschaftspolitik sorgen.
In Deutschland eskalierten die Konflikte, als Lafontaine es wagte, einige Steuerprivilegien der Wirtschaft anzutasten und die milliardenschweren Rücklagen der Energiekonzerne zu besteuern. Diese drohten am Montag vor Lafontaines Rücktritt, die sogenannten "Energiekonsensgespräche" über den Ausstieg aus der Atomenergie zu boykottieren, wenn die Steuer nicht zurückgenommen werde.
Zwei Tage später - am Mittwoch - wies Schröder Lafontaine im Kabinett zurecht. Er lasse mit sich keine Politik gegen die Wirtschaft machen, sagte er, und drohte indirekt mit dem Rücktritt: "Es wird einen Punkt geben, wo ich die Verantwortung für eine solche Politik nicht mehr übernehmen werde." Informationen über diese Sitzung wurden anschließend gezielt der Presse zugespielt. Am Tag darauf trat Lafontaine zurück. Die Vertreter der Wirtschaft und vor allem die Börsen jubelten, als gelte es - wie der Spiegel schrieb - "den zweiten Sieg des Kapitalismus über die Planwirtschaft zu feiern". Der Dax stieg innerhalb weniger Stunden um sechs Prozent.
Die unmittelbare Folge von Lafontaines Rücktritt wird ohne Zweifel ein weiterer Rechtsruck in der Wirtschaftspolitik sein. Der Schock war kaum verklungen, da meldeten sich innerhalb der SPD die ersten Stimmen, die einen wirtschaftsfreundlicheren Kurs verlangten.
Die noch von Lafontaine ausgearbeitete erste Stufe der Steuerreform soll zwar wie geplant am 19. März im Bundesrat verabschiedet werden, weil sich sonst riesige zusätzliche Haushaltslöcher auftäten. Aber bei den nächsten Stufen soll dann - laut einer Absprache zwischen Schröder und dem neuen Finanzminister Hans Eichel - "auf die Wirtschaft zugegangen werden". Die deutsche Steuerpolitik, so Kanzler Schröder, soll in Zukunft im Einklang mit der europäischen und insbesondere der britischen stehen. Bereits zum ersten Januar 2000 sollen die Unternehmensteuern massiv gesenkt werden.
Das wird nicht ohne gewaltige Kürzungen im Sozialbereich und eine Erhöhung der Mehrwertsteuer abgehen. Schon jetzt wird für das Jahr 2000 mit einer Haushaltslücke von zwanzig bis fünfzig Milliarden Mark gerechnet, für die es nach Lafontaines Plänen noch keine Deckung gab. Bei einer Senkung der Unternehmenssteuern wird sich dieses Loch zusätzlich vertiefen.
Die Grünen, die sich bisher in der SPD an Lafontaine orientierten, haben bereits deutlich gemacht, daß sie den neuen wirtschaftsfreundlichen Kurs voll mittragen. Es gelte "die Balance zwischen sozialer Gerechtigkeit und Investitionsorientierung neu zu finden", erklärte Joschka Fischer im Spiegel. Das Klima zur Wirtschaft müsse wesentlich verbessert werden.
Auch die im Frankfurter Kreis organisierte Parteilinke hat sich nach kurzer Trauer über den Abgang ihres Idols mit dem neuen Kurs abgefunden und will bei der Wahl des neuen Parteivorsitzenden Schröder unterstützen.
Es stellt sich die Frage, weshalb Lafontaine kampflos kapituliert und nicht den geringsten Versuch unternommen hat, seine Auffassungen zu verteidigen und Unterstützung dafür zu gewinnen.
Durch seinen überraschenden Rücktritt, auf den selbst seine engsten Vertrauten nicht vorbereitet waren, hat er dem rechten Wirtschaftsflügel regelrecht den Weg an die Spitze der Partei geebnet. Schröder, der jetzt neben dem Amt des Kanzlers auch den Parteivorsitz übernimmt, hätte dafür unter normalen Verhältnissen kaum eine Mehrheit erhalten.
Der Grund für dieses Verhalten muß vor allem in den objektiven Verhältnissen gesucht werden. Die Vorherrschaft milliardenschwerer internationaler Finanzkonzerne über alle Bereiche der Wirtschaft läßt keinen Spielraum für sozialen Ausgleich mehr zu. Lafontaines Behauptung, die Auswirkungen der Globalisierung ließen sich durch eine Wirtschaftspolitik im Stile der sechziger und siebziger Jahre in Schach halten, hat sich innerhalb weniger Wochen als haltlose Illusion erwiesen.
Sein Abgang bezeichnet für die SPD einen ähnlichen Einschnitt wie die Annahme des Godesberger Programms vor vierzig Jahren. Damals verabschiedete sie sich endgültig von ihren Wurzeln als Arbeiterpartei und bezeichnete sich als Volkspartei. Aber dieser Wandel fand im Zeichen des sozialen Ausgleichs und des raschen wirtschaftlichen Aufschwungs statt. Über dem Godesberger Programm prangten die Worte "Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität".
Diese Worte hat Lafontaine nun an den Schluß seines kurzen Rücktrittschreibens an die Partei gesetzt, in dem es heißt: "Ich wünsche Euch für die Zukunft eine erfolgreiche Arbeit für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität." Aber sein eigener Rücktritt ist der Beweis dafür, daß sich diese Prinzipien unter den Bedingungen der Globalisierung mit den Methoden der SPD nicht mehr verwirklichen lassen. Die SPD ist dabei, sich endgültig von einer Volks- in eine Wirtschaftspartei zu verwandeln, die jeder Form von Gerechtigkeit und Solidarität ablehnt. Sie geht denselben Weg, den die meisten sozialdemokratischen Parteien in Europa bereits gegangen sind.
Hätte Lafontaine der Wirtschaftslobby, die der Regierung immer unverschämter ihre Bedingungen diktiert, die Stirn geboten, er wäre ohne Zweifel auf Unterstützung gestoßen. Allerdings weniger innerhalb der SPD, als unter breiteren Bevölkerungsschichten. Er hätte gesellschaftliche Kräfte auf den Plan gerufen, die er auf keinen Fall wecken will. Deshalb hat er stillschweigend kapituliert.