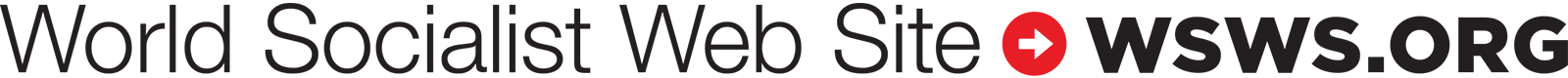Ein Film, in dessen ersten Minuten Schulkinder in fünf verschiedenen Sprachen „Ich liebe dich“ vorsagen, ist der Lieblingsfilm des Publikums im diesjährigen Wettbewerb der Berlinale. Herr Bachmann und seine Klasse von Maria Speth als Gewinner des Publikumspreises ist eine eindrucksvolle Hommage an internationale Solidarität.
Dreieinhalb Stunden lang dokumentiert der Streifen, wie ein engagierter Lehrer in einer kleinen hessischen Industriestadt seinen Schülern aus unterschiedlichen Ländern hilft, sich zu Hause zu fühlen und Weltbürger zu werden.
Rund 60.000 Besucher nahmen an den Open-Air-Vorführungen des Berlinale Summer Special teil, das am letzten Sonntag zu Ende ging. 8500 Besucher beteiligten sich an der Abstimmung des einmalig vergebenen Publikumspreises „Wettbewerb 2021“. Der neue Preis sollte dem Publikum mehr Mitsprache ermöglichen, nachdem es durch die Zweiteilung des Filmfestivals in der ersten Runde Anfang März ausgeschlossen war. Die Goldenen und Silbernen Bären hatten die Jurys bereits Anfang März nach dem Online-Screening für die Filmbranche und die Presse festgelegt. Herr Bachmann und seine Klasse erhielt hier den „Silbernen Bären Preis der Jury“.
Stadtallendorf, die Stadt von Bachmanns Schule, ist nicht zufällig gewählt: Sie ist eine „deutsche Stadt mit einer langen Geschichte von Ausgrenzung wie auch Integration“, heißt es im Programmtext. In der Tat: Diese kleine mittelhessische Stadt, die bis zum Zweiten Weltkrieg noch ein katholisches Dorf mit einer kleinen jüdischen Gemeinde war, wurde ab 1938 zum geheimen Zentrum der Nazi-Rüstungsproduktion mit zwei Sprengstofffabriken aufgebaut. Hier wurden mehr als 17.000 Zwangsarbeiter aus 20 europäischen Ländern und der Sowjetunion eingesetzt, von denen Tausende die schrecklichen Bedingungen nicht überlebten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden hier Vertriebene und Flüchtlinge aus den Ostgebieten, angesiedelt, ab den 60er Jahren entstand neue Industrie, in denen viele Gastarbeiter vor allem aus der Türkei arbeiteten. Rund siebzig Prozent der knapp 21.000 Einwohner haben Migrationshintergrund, in Bachmanns Klasse sind neun verschiedene Nationalitäten vertreten.
Der Gewinner des Publikumspreises ist, wie die WSWS im April schrieb, „ein mächtiges Gegenmittel für den giftigen Nationalismus der Neuen Rechten“ und für alle politischen Versuche, Arbeiter zu spalten und gegeneinander aufzuhetzen.
Trotz der beschränkten Filmauswahl im Corona-Jahr – von den ursprünglich rund 160 ausgewählten Filmen, darunter 15 Wettbewerbsfilme, wurden im Summer Special 126 gezeigt – bot die diesjährige Berlinale in diesem Jahr viel Interessantes und Sehenswertes. Eine Vielzahl jüngerer Regiearbeiten reflektiert mit Fantasie, Formenvielfalt, Nachdenklichkeit oder auch Witz eine brüchige Welt.
Bereits der Beginn des Summer Specials am 9. Juni steckte den Rahmen ab: Der Eröffnungsfilm von Kevin McDonald Der Mauretanier über das berüchtigte US-Gefangenenlager Guantanamo zeigt die veränderte Rolle der USA, die nicht mehr „Demokratie und Freiheit“ repräsentieren, sondern mörderische Kriege führen und die demokratischen Rechte brutal angreifen.
Auch in Deutschland und den anderen Ländern der Welt verschärft sich die Lage, wie die WSWS in ihrem Artikel zur Eröffnung betonte. Millionen wird in der Zeit der Corona-Pandemie vor Augen geführt, dass der Kapitalismus, der nach der Auflösung der Sowjetunion seinen Triumph feiern ließ, die Herrschaft einer gierigen Minderheit bedeutet, die Profite über Leben stellt und Milliarden für neue Kriege und Unterdrückung ins Militär und in die Polizei pumpt.
Eine ganze Anzahl Filme spiegelt diese veränderte Situation wider und lässt frischen Wind aufkommen. Oder wie der künstlerische Leiter der Berlinale Carlo Chatrian zu Beginn sagte, viele Filme seien „freier und experimenteller“ durch Rückgriffe auf Formen wie Märchen, Science Fiction, Krimi oder Roadmovie und antworteten damit auf die gegenwärtigen Unsicherheiten in der Gesellschaft. Es sei jedoch schwierig, „jetzt schon zu theoretisieren, weil wir mittendrin sind“.
Gestörte zwischenmenschliche Kommunikation
Doch schon jetzt kann man einige Tendenzen aufzeigen.
Ein wiederkehrendes Thema der diesjährigen Berlinale ist die scheinbar verloren gegangene zwischenmenschliche Beziehung, die in der Corona-Zeit besonders sichtbar geworden ist. Die vergangenen Monate des Abstandhaltens, der nur virtuellen Beziehung zu Freunden, Verwandten, Kollegen haben die Sehnsucht nach echten menschlichen Kontakten, nach Zusammenhalt und Gemeinsamkeit schmerzlich spüren lassen.
Als zweitbesten Film hat das Publikum bezeichnenderweise Ich bin Dein Mensch von Maria Schrader ausgewählt, in der Alma, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin des Pergamon-Museums in Berlin, wunderbar gespielt von Maren Eggert (Silberner Bär für beste Hauptdarstellerin), im Rahmen eines Tests drei Wochen lang mit einem Roboter-Mann (Dan Stevens) zusammenleben soll. Getestet wird, ob programmierbare künstliche Intelligenz den idealen Lebenspartner herstellen kann.
Alma ist widerwillig, unterwirft sich aber dem Test, wobei sie sich entgegen ihren wissenschaftlichen Überzeugungen und Erwartungen in den Roboter verliebt. Am Ende erweist sich bizarrer Weise auch der Roboter-Mann, den Alma vor Ende des Tests aus der Wohnung wirft, als anhänglich an die echte menschliche Frau. Statt in die Fabrik zurückzukehren, wartet er drei Tage lang auf einer Bank im Freien auf Alma.
Der tragikomische Film mit Science-Fiction-Zügen greift ein uraltes Thema auf, die Beziehung von Mensch und Maschine. Wie geht der Mensch mit von ihm geschaffener künstlicher Intelligenz um, können Roboter lebendige Menschen ersetzen? Und ebenso die Umkehrung: Verhalten sich lebendige Menschen in Beziehungen bereits wie Roboter, mechanisch, emotionslos?
Weil die zwischenmenschlichen Beziehungen auf dem Hintergrund der gesellschaftlichen Krise brüchig sind, rücken sie stärker ins Zentrum. Man sehnt sich nach menschlicher Wärme und Nähe, die sich manchmal als unerfüllter Alltagstraum, wie im georgischen Wettbewerbsfilm von Alexandre Koberitze Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen?, oder als düster-pessimistischer Rückblick äußern, wie im vietnamesischen Encounters-Beitrag Vi von Le Bao.
In Koberitzes Film treffen sich zufällig eine Frau und ein Mann, verabreden sich für den nächsten Tag und sind – durch einen magischen Fluch getroffen – plötzlich völlig anders aussehende Menschen. Sie erkennen sich weder am Treffpunkt wieder, noch später, als sie für den gleichen Café-Besitzer jobben, und noch nicht einmal, als am Ende eine Filmemacherin sie als ein perfektes Paar in ihrem Film darstellt.
In dem vietnamesischen Film Vi, der den Spezialpreis der Jury in der Sektion Encounters erhielt, schließen sich angesichts schierer Armut in den Slums am Hafen von Saigon ein afrikanischer Fußballer, der wegen eines Beinbruchs aus dem Mannschaft entlassen wird, und vier ältere Frauen zusammen. Sie leben, kochen, schlafen gemeinsam und meistens nackt in primitiven Kellergewölben, wo sie eine Art Rückkehr zum Urzustand der Menschheit praktizieren.
Wie kann man die Geschichte erleben
Beim Berlinale-Festival gab es in der Vergangenheit immer wieder interessante Filme, die sich mit geschichtlichen und politischen Ereignissen befassten. Dies trifft auch auf dieses Jahr zu.
Dazu gehören einige osteuropäische Filme, die dreißig Jahre nach der Wiedereinführung des Kapitalismus die Situation in ihren Ländern kritisch beleuchten. Dies betrifft den Gewinner des Goldenen Bären, Radu Judes Gesellschaftssatire Bad Luck Banging oder Loony Porn, die die obszönen Verhältnisse in der rumänischen Gesellschaft anklagt, auch in gewisser Weise den ungarischen Antikriegsfilm Natural Light von Denés Nagy über die Kollaboration mit den Nazis, die die heutige ungarische Regierung rechtfertigt.
Im Debütfilm des georgischen Regisseurs Salomé Jashi Taming the Garden lässt ein steinreicher georgischer Oligarch uralte Bäume in den Dörfern ausreißen, um sie per Schiffsfähre zu seinem Park zu bringen, der sein Privateigentum ist. Im Zentrum des Dokumentarfilms In Bewegung bleiben stehen die Tänzer der Komischen Oper in Ostberlin, die bei Auftritten im Westen die Hälfte ihrer Mitglieder verlor. Die Interviews mit denjenigen, die gingen, und denjenigen, die blieben, machen die Zeit kurz vor dem Mauerfall lebendig.
Auffällig waren in der diesjährigen Berlinale aber auch neue Formen des Umgangs mit Geschichte – manchmal noch nicht vollkommen, aber erfrischend und überraschend wirksam.
Ein Beispiel ist der Wettbewerbsfilm Memory Box von Joana Hadjithomas und Khalil Joreige, der den Libanon-Krieg der 80er Jahre thematisiert. Ein 16-jähriges Mädchen entdeckt in einer Kiste voller Fotos, Tagebuchseiten, Liebesbriefe, Kassettenaufnahmen die Geschichte der Jugend ihrer Mutter in Beirut. Sie versetzt sich in diese Zeit des Kriegs, verwebt sie mit ihrer eigenen Jugend und vergisst die Instagram-Chats mit ihren Freunden.
Formal innovativer ist A pas aveugles von Christophe Cognet über Fotografien von KZ-Häftlingen, die er selbst „als Akt des Widerstands“ bezeichnet. Er präsentiert sie auf Fotoplatten am selben Ort in einer Weise, dass man das Gefühl bekommt, die Dinge bewegen sich und die Opfer seien gegenwärtig.
Der thailändische Schwarz-Weiß-Film Come here (Jai jumlong) handelt von vier jungen Schauspielstudenten, die ein Denkmal des Zweiten Weltkriegs besuchen, die „Schienen des Todes“, eine Eisenbahnlinie, die die japanischen Besatzer mit Zehntausenden Zwangsarbeiter zwischen Bangkok und dem westlichen Thailand erbauen ließen. Die meisten verloren ihr Leben.
Auch hier überlappt sich die Geschichte mit heute, durch eine Szene einer Migrantin im Wald, die vor der modernen Zwangsarbeit in Thailand geflüchtet ist. Als sie in einem Bach ihr Gesicht wäscht, erscheint als Spiegelbild das Gesicht einer anderen Person. Ihr gehe es um „unsere Unfähigkeit, jemand anderes zu sein“, erklärt die Regisseurin Anocha Suwichakornpong in einem Interview, um die mangelnde Empathie für das Leiden anderer Menschen.
Auch einige Kurzfilme sind interessant: Deine Straße von Güzin Kar erinnert auf erschütternde Weise an einen der ersten rassistischen Anschläge nach der deutschen Einheit, den Brandanschlag am 29. Mai 1993 in Solingen, dem die meisten Mitglieder zweier türkischer Familien zum Opfer fielen. Man erfährt dies nur nach und nach, während die Kamera über eine öde Straße in einem Bonner Gewerbegebiet streift und dabei eine Erzählstimme (Sibylle Berg) monoton berichtet, dass diese Straße nach dem jüngsten Opfer, der vierjährigen Saime Genc, benannt wurde. „Schlaf gut, kleine Saime Genc“, sagt sie am Ende des filmischen Requiems.
In einem anderen Kurzfilm, One Hundred Steps, verbinden Besucher eines Schlosses in Irland und eines Stadtpalais in Marseilles die Vergangenheit mit der Gegenwart, indem sie die prunkvollen Gemächer für sich nutzen, singen, musizieren, Karten spielen und, wie ein Kind, sich sogar ins Himmelbett legen.
Das wachsende Interesse einer jungen Generation an Geschichte ist sichtbar, dennoch bleiben Fragezeichen und Verwirrung. Memory Box endet mit einer Fahrt im heutigen Beirut, wo die Mutter das neue Haus zeigt, das auf den Trümmern des Elternhauses erbaut wurde. Nach dem Begräbnis ihrer Freundin sieht man eine ausgelassene Tanzparty, und zuletzt schaut die Tochter der untergehenden Sonne über Beirut zu. Das Leben geht weiter, die Gegenwart gewinnt Oberhand über die Geschichte? Ein etwas romantisierender Kurzschluss.
Kapitalismus und Klassenkampf
Auch dies war eine interessante Tendenz in der Berlinale 2021: Der Kapitalismus zeigt sich als Klassengesellschaft mit zunehmend gewaltsamen Konflikten. Bereits in der letzten Berlinale die noch kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie stattfinden konnte, gab es ein „neues Interesse am Leben der Arbeiter“, wie die WSWS damals schrieb.
In diesem Jahr kommt der Klassenkampf zurück auf die Leinwand, die Zeit des Klassenkompromisses ist vorbei. Zugleich zeigt die herrschende Klasse ihr wahres, brutales Gesicht. Hier sind nur drei sehenswerte Filme genannt, die die WSWS noch ausführlicher behandeln wird.
In Die Saat von Mia Maariel Meyer erlebt ein Bauarbeiter, wie nur noch der Profit der Immobilienspekulanten zählt, die langjährige Arbeit für ein Familienunternehmen nichts mehr gilt. Am Ende kommt es zur gewaltsamen Gegenwehr.
Im Film Azor des jungen Schweizer Regisseurs Andreas Fontana wird die Zusammenarbeit der Schweizer Banken mit der argentinischen Diktatur Anfang der 80er Jahre gezeigt, die dem Finanzkapital lukrative Geschäfte mit geraubten Gütern von ermordeten Oppositionellen verschafft.
Die Gesellschaftssatire Blutsauger von Julian Radlmaier zeigt in witziger Weise, dass nicht „chinesische Flöhe“ (ein Hinweis auf Corona), sondern die adlige Großaktionärin und Multimillionärin Octavia die Quelle für die überall auftretenden blutigen Bisse ist. Am Ende befindet sich Octavia in trauter Eintracht mit einem Faschisten.
Mehr lesen
- 71. Berlinale eröffnet Publikumsfest mit Guantanamo-Film „Der Mauretanier“
- „Je suis Karl“ und „Herr Bachmann und seine Klasse“: Die Neue Rechte und ein mächtiges Gegenmittel
- „Natural Light“ – wie Krieg und Barbarei ein menschliches Gesicht zeichnen
- Radu Judes „Bad Luck Banging oder Loony Porn“: Eine bissige Satire gegen obszöne Zustände in der kapitalistischen Gesellschaft